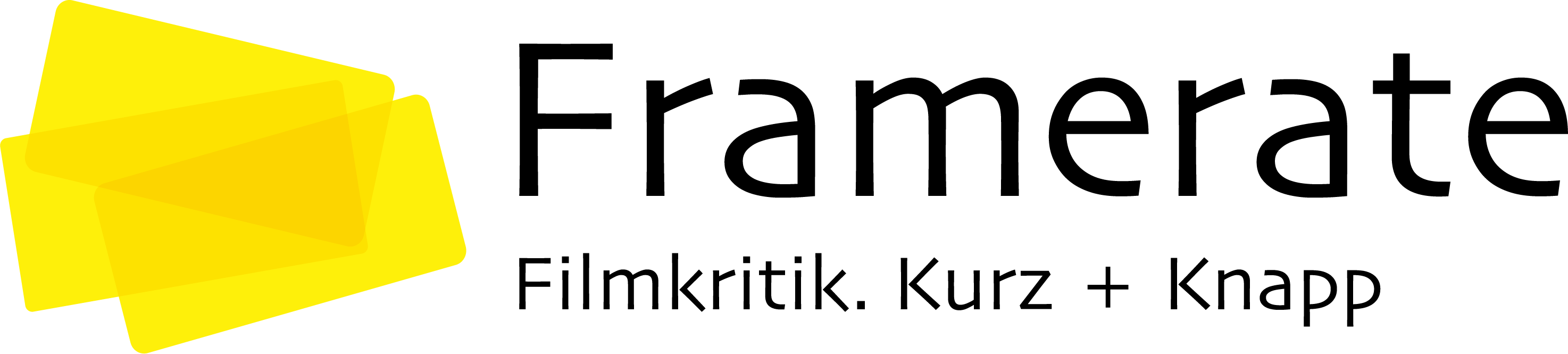ENNIO MORRICONE – DER MAESTRO
Kinostart 22. Dezember 2022
Meist genügt nur ein Takt, um zu erkennen, dass die Filmmusik von ihm stammt. Mundharmonika, überirdischer Frauengesang – Ennio Morricone wertet mit seinem unverkennbaren Sound zahllose Spaghettiwestern auf. Der Mann war schon zu Lebzeiten eine Legende. Höchste Zeit für einen Dokumentarfilm über den genialen Komponisten. Regisseur Giuseppe Tornatore arbeitet die faszinierende Karriere seines langjährigen Freundes in „Ennio Morricone – Der Maestro“ chronologisch ab. Das ist zwar konventionell gemacht, aber auch angenehm unaufgeregt.
In gleichermaßen anrührenden wie erhellenden Interviewszenen erinnert Morricone sein Leben von der Kindheit bis zum sehr späten Oscargewinn für „The Hateful Eight“. Dazwischen gestreut kommen in kurzen O-Tönen – etwas zu hektisch aneinandergereiht – Weggefährten wie Quentin Tarantino, Bernardo Bertolucci, Joan Baez, Hans Zimmer, Bruce Springsteen oder Clint Eastwood zu Wort.




Tatsächlich ist die größte Überraschung, wie viele eingängige Schlager-Hits Morricone zu Beginn seiner Karriere in den 50er und 60ern geschrieben hat. Auch dass er vor seinen Welterfolgen wie „Spiel mir das Lied vom Tod“ oder „Es war einmal in Amerika“ unzählige Filmmusiken für heute längst vergessene italienische Filme komponiert hat, dürfte den Wenigsten bekannt sein.
Morricone ist während seiner gesamten Karriere bereit, zu experimentieren, sich neu zu erfinden. Filmen verleiht er mit seiner Musik eine Dimension, die mancher Regisseur selbst noch gar nicht begriffen hat. Bei so viel aufregender Kreativität braucht es keine filmischen und erzählerischen Tricks. „Ennio Morricone – Der Maestro“ ist zwar ein etwas artig gemachter, aber trotzdem spannender Film über einen genialen Ausnahmekünstler.
INFOS ZUM FILM
Originaltitel „Ennio“
Italien / Belgien / Japan / Niederlande 2021
156 min
Regie Giuseppe Tornatore
alle Bilder © PLAION PICTURES