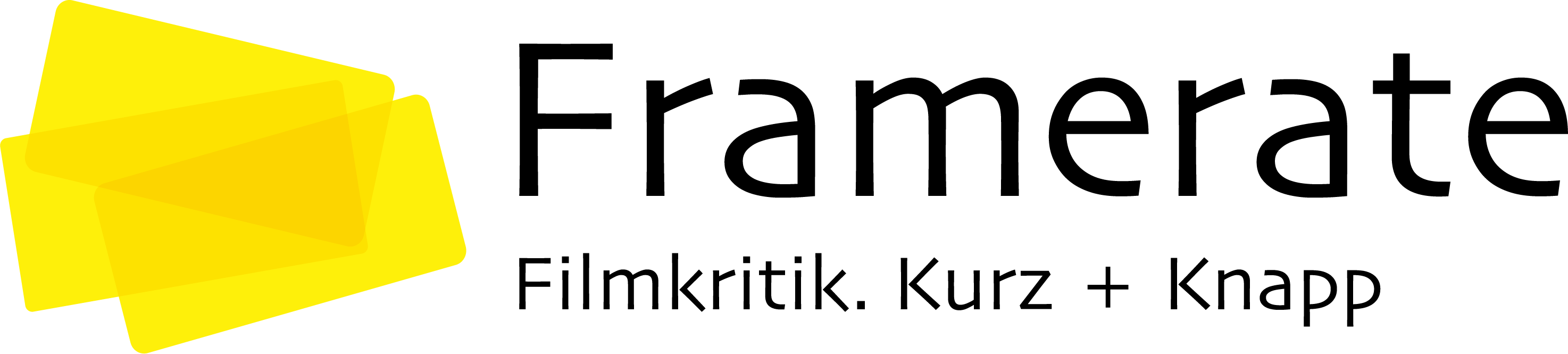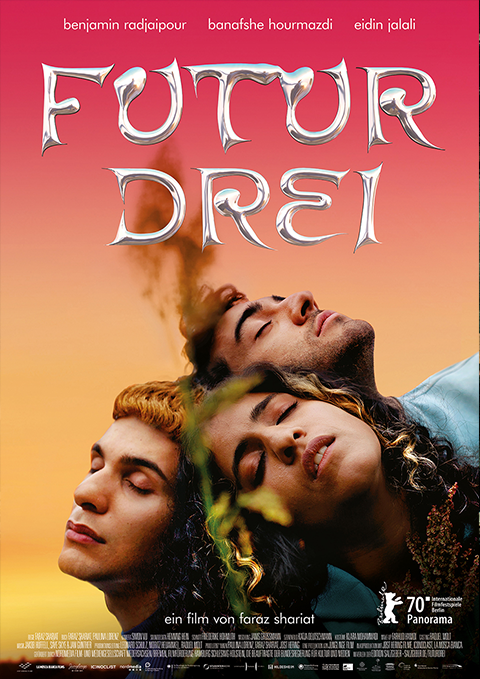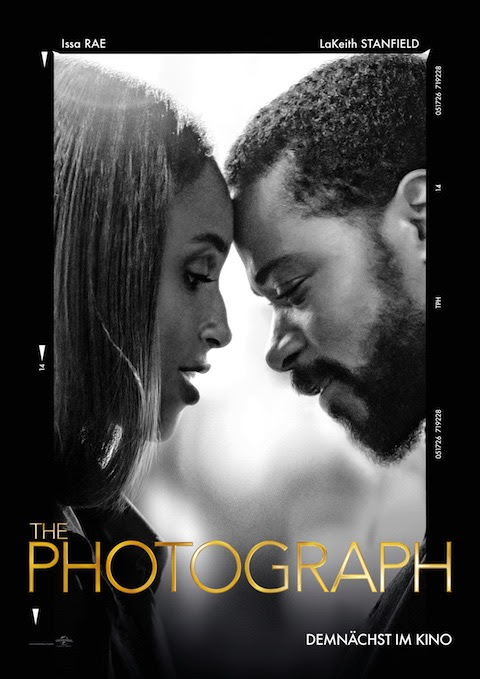Alles schnafte: Steffi ist 16, hat einen schnuckligen Freund, will demnächst ihre Ausbildung bei der Polizei beginnen. Doch dann erfährt sie, dass sie unheilbar an Krebs erkrankt ist und nur noch kurze Zeit zu leben hat. Bei solchen Nachrichten verschieben sich die Prioritäten. Eigentlich wollte sie auf der bevorstehenden Klassenfahrt nach Paris ihr erstes Mal erleben, aber die besorgten Eltern verbieten die Reise und drängen, besser gleich mit der Chemotherapie zu beginnen. Steffi weigert sich – die letzten Wochen ihres Lebens will sie selbst bestimmen und brennt kurzerhand mit dem coolen Zirkusjungen Steve durch. Bei ihrem tragikomischen Roadtrip nach Frankreich verlieben sich die beiden ineinander.
Boy meets girl, girl get’s sick, girl dies, boy is sad.
Keine neue Geschichte und seit „Love Story“ ein beliebtes Thema für Tearjerker-Filme. Der deutschen Produktion „Gott, Du kannst ein Arsch sein“ hätte es gutgetan, ein paar Kalendersprüche weniger ins Dialogbuch zu schreiben: „Der Weg ist das Ziel“ – wirklich? Ein seichter Mainstream-Pop-Soundtrack, der wie eine Dauerschleife aus dem Privatradio klingt, macht die Sache auch nicht erträglicher. Wenn dann noch Til Schweiger mitspielt, setzen instinktiv Fluchtreflexe ein. Ist so, kann man nix gegen machen. Auch Filme können ein Arsch sein.
Was die RTL-Produktion rettet, ist seine tolle weibliche Besetzung: Heike Makatsch als zwischen Trauer und Hoffnung hin- und her gerissener Mutter, Jasmin Gerat als herzenswarme Barfrau und vor allem Sinje Irslinger in der Hauptrolle – authentisch und mit jeder Menge Witz und Charme gibt sie dem Film die nötige Erdung und bewahrt „Gott, Du kannst ein Arsch sein“ davor, eine allzu glatte Teenie-Schmonzette zu werden.
Liest sich wie eine Bravo-Lovestory, doch Zynismus ist fehl am Platz: der Film basiert auf den Tagebucheinträgen der 15-jährigen Stefanie, die 296 Tage nach ihrer Krebs-Diagnose starb.

97 min
Regie André Erkau
Kinostart 01. Oktober 2020